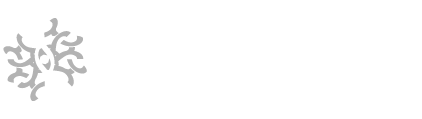Grundlagen · Gerichtssystem · Vertretung · Opt-out
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Grundzüge und Grundlagen dieses Einheitspatentsystems, bestehend aus Einheitspatent und Einheitlichem Patentgericht vor. Dies soll jedoch nur zur Einführung dienen und stellt insbesondere keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Weiterhin kann es nicht das im Einzelfall unbedingt notwendige Befassen mit den Details des Einheitspatentsystems ersetzen. Hier möchten wir unter anderem auf die – auch von Mitgliedern unserer Kanzlei verfassten – Fachpublikationen verweisen, stehen aber auch jederzeit für eingehende Beratung zur Verfügung.
Die Grundlagen
-
+ Wie kam es zum Einheitspatent?
Derzeit erteilt das Europäische Patentamt für die beteiligten Vertragsstaaten europäische Patente, die nach der Erteilung in ein Bündel nationaler Patente („Bündel-Patent“) zerfallen und in dem jeweiligen Vertragsstaat einem national erteilten Patent gleich stehen. Wenn innerhalb des europäischen Binnenmarkts eine europaweite Patentverletzung erfolgt, ist der Patentinhaber grundsätzlich gehalten, in jeden einzelnen Vertragsstaat eine separate Patentverletzungsklage einzuleiten. Dies ist sowohl für den Patentinhaber als auch für den vermeintlichen Verletzer mit entsprechend hohen Rechtsverfolgungskosten verbunden. Darüber hinaus sind auch noch inhaltlich unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen möglich, so dass in dem einen Teil der EU ein Produkt verboten wäre und in einem anderen Teil nicht. Diese Situation wurde zunehmend als unbefriedigend empfunden.
Zur Lösung dieser Situation wurden mehrere Anläufe unternommen, unter anderem wurde auf EU-Ebene zunächst versucht vergleichbar zur EU-Gemeinschaftsmarke und dem EU-Gemeinschaftsdesign ein EU-Gemeinschaftspatent zu schaffen. Die entsprechenden Gesetzesvorhaben wurden jedoch nie ausreichend ratifiziert. Ein wichtiges Gegenargument war dabei, dass zu dem erfolgreich tätigen Europäischen Patentamt kein paralleles EU-Patentamt geschaffen werden sollte, wodurch eine wünschenswerte europaweite Harmonisierung im Patentwesen beeinträchtigt werden könnte.
Daher wurde nun ein anderer Ansatz gewählt, bei dem das Europäische Patentamt mit einbezogen wird. Hierbei wurde von der im hierfür geltenden Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass das Europäische Patentamt auch für eine Gruppe von Vertragsstaaten ein einheitliches Patent erteilen kann (Art. 142 EPÜ). Da sämtliche EU-Staaten auch Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind, wurde zunächst beabsichtigt, mittels des Europäischen Patentamt ein einheitliches EU-Patent für die gesamte EU zu erteilen. Da aber die EU-Staaten Spanien und Italien diese Initiative blockiert hatten, wurde dieses Vorgehen ohne Spanien und Italien im Rahmen der in der EU neu geschaffenen Möglichkeit der „verstärkten Zusammenarbeit“ mit den übrigen EU-Staaten vorangetrieben. Hierzu wurden einerseits die Grundlagen für das vom Europäischen Patentamt für die Vertragsstaaten der verstärkten Zusammenarbeit zu erteilende nun als „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnete „Einheitspatent“ (EU-Verordnung Nr. 1257/2012) und ein anzuwendendes Übersetzungsregime (EU-Verordnung Nr. 1260/2012) geschaffen sowie auch ein für die Vertragsstaaten dieser verstärkten Zusammenarbeit einheitliches gemeinsames Patentgerichtssystem (Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht) vereinbart. Italien hat übrigens inzwischen seine Meinung geändert und ist dem Einheitspatentsystem beigetreten.
Derzeit gehören dem Einheitspatentsystem die folgenden Länder an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen. Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal und Schweden.
-
+ Was ist das Einheitspatent?
Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“) ist ein vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für alle Mitgliedsstaaten des Übereinkommens erteiltes Patent. Es hat für sämtliche erfasste Staaten die gleiche Wirkung, so dass in einem einzigen Gerichtsverfahren für alle diese Staaten eine gemeinsame einheitliche Gerichtsentscheidung getroffen werden kann. Dies gilt sowohl für die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, als auch für die Frage, inwieweit das Einheitspatent zu Recht erteilt wurde und rechtsbeständig ist. Der Schutzbereich des Einheitspatents wird bezüglich einer bestimmten vermeintlichen Verletzungshandlung in einem einzigen Gerichtsverfahren ausgelegt und auf alle von dem Einheitspatent erfasste EU-Staaten gleichzeitig und ohne nationale Abweichungen angewendet. Dadurch wird ein einzelner Rechtstitel verliehen, der in allen vom Einheitspatent erfassten EU-Staaten vollstreckt werden kann (vgl. auch EU-Verordnung Nr. 1215/2012 „Brüssel Ia“).
-
+ Was sind die Vorteile des Einheitspatents?
Für das Einheitspatent fällt mit Wirkung für alle von dem Einheitspatent erfassen EU-Staaten jährlich nur eine einzige Jahresgebühr an. Dadurch entfällt der Verwaltungsaufwand, in unterschiedlichen Staaten jeweils unterschiedlich hohe Jahresgebühren zu gegebenenfalls unterschiedlichen Terminen entrichten zu müssen.
Außerdem kann das Einheitspatent mit nur einer einzigen Handlung in Kraft gesetzt werden, anders als bei bisherigen (Bündel-)Patenten, wo in jedem Land einzeln validiert werden muss.
Vermeintliche Verletzungshandlungen in von dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“) erfassten EU-Staaten können in einem einzigen Gerichtsverfahren gerichtlich verfolgt werden, ohne dass es erforderlich ist in jedem einzelnen EU-Staat ein Klageverfahren einzuleiten. Dadurch können die Rechtsverfolgung und die Rechtsverfolgungskosten auf ein einziges Verfahren konzentriert werden. Sich widersprechende Gerichtsentscheidungen für unterschiedliche Staaten werden vermieden.
Durch die einheitliche Wirkung des Einheitspatents wird eine Harmonisierung des Patentschutzes erreicht. Dadurch ist es nicht mehr erforderlich, eine für jeden von dem Einheitspatent erfassten EU-Staat eine nationale Besonderheiten, insbesondere bezüglich einer Verletzung im Äquivalenzbereich, berücksichtigende separate Begutachtung des Schutzbereichs vorzunehmen.
-
+ Was sind die Nachteile des Einheitspatents?
Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“) kann in einem einzigen Gerichtsverfahren zentral mit Wirkung für sämtliche von dem Einheitspatent erfassten EU-Staaten beschränkt oder vernichtet werden, auch wenn lediglich nur in einem Teil dieser EU-Staaten über einen vermeintlichen Verletzungstatbestand entschieden werden soll. Dadurch ist dem Patentinhaber die Möglichkeit genommen, in einem anderen EU-Staat bei einer anderen vermeintlichen Verletzungshandlung eine andere Beschränkungsstrategie zu wählen.
Zudem ist die Strategie nicht mehr möglich bei einer europaweiten vermeintlichen Patentverletzung einen auf Deutschland beschränkten kostengünstigen Pilotprozess zu führen und sich auf Basis dieses Gerichtsverfahrens für ganz Europa zu vergleichen. Stattdessen müssten die streitwertbasierten Kosten des zugehörigen Gerichtsverfahrens automatisch auf Basis der jeweiligen addierten Streitwerte in sämtlichen von dem Einheitspatent erfassten EU-Staaten berechnet werden.
Auf das Einheitspatent kann nur als Ganzes verzichtet werden. Das selektive Aussortieren einzelner von dem Einheitspatent erfasster EU-Staaten, beispielsweise um durch eine Reduzierung des Schutzterritoriums Jahresgebühren zu sparen, ist nicht möglich.
-
+ Wie erhält man ein Einheitspatent?
Der Patentanmelder startet in der bisher üblichen Art und Weise beim Europäischen Patentamt ein Patentanmeldeverfahren. Wenn das Europäische Patentamt die Patenterteilung beschließt, kann der Patentanmelder beantragen, dass anstelle jeweils separater (Bündel-)Patente für die von dem europäische Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“) erfassten EU-Staaten das für diese EU-Staaten gemeinsame Einheitspatent erteilt wird. Dies wird in einem vom Europäischen Patentamt geführten Register eingetragen. Der Antrag ist beim Europäischen Patentamt zu stellen und ist gebührenfrei, bei Antragstellung muss die Übersetzung (s. nachfolgend) mit eingereicht werden.
-
+ Wie hoch sind die Kosten des Einheitspatents?
Bis zur Erteilung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“) fallen für das Einheitspatent die gleichen Kosten wie für ein herkömmliches europäisches (Bündel-)Patent an. Da für das in der Verfahrenssprache vor dem Europäischen Patentamt erteilte Einheitspatent keine weiteren Übersetzungen der Patentschrift vorgesehen sind, können gegebenenfalls im Vergleich zu einem herkömmlichen europäischen (Bündel-)Patent Übersetzungskosten zur Erfüllung nationaler Erfordernisse der relevanten Vertragsstaaten eingespart werden.
Lediglich für einen Übergangszeitraum von maximal 12 Jahren ist bis zum Vorliegen qualitativ ausreichend hoher Computerübersetzungsmöglichkeiten eine Übersetzung des Einheitspatents in eine weitere Sprache erforderlich, die Amtssprache der EU ist, sofern das Einheitspatent in Englisch erteilt wurde. Ansonsten ist eine Übersetzung auch des Anmeldetextes in Englisch einzureichen.
Die jährlich anfallenden Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Einheitspatents sollen nach der Erteilung im Wesentlichen den Jahresgebühren entsprechen, die für die vier Vertragsstaaten anfallen würden, für die am häufigsten das europäische (Bündel-)Patent Wirkung entfaltet („validiert wird“). Beispielsweise sind für die Jahresgebühren des Einheitspatents zur Zeit 35€ für das zweite Patentjahr, 1.175€ für das zehnte Patentjahr und 4.855€ für das zwanzigste Patentjahr vorgesehen.
-
+ Welchen Schutz bietet das Einheitspatent?
Das Einheitspatent bietet denselben Schutz wie ein bisheriges (Bündel-)Patent, welches vor dem Europäischen Patentamt erteilt wurde. Der einzige Unterschied ist, dass das Einheitspatent zwingend vor dem Einheitlichen Patentgericht verhandelt wird, während es für eine Übergangszeit für bisherige europäische (Bündel-)Patente die Möglichkeit gibt, ein „opt out“ eintragen zu lassen, d.h. dann würden die nationalen Verletzungsgerichte zuständig.
Ob und wie das Einheitliche Patentgericht in seiner Urteilspraxis von der bisherigen Praxis z.B. der deutschen Gerichte abweichen wird, bleibt dabei abzuwarten. Dies ist schwer abzuschätzen, zumal sich ja auch die Rechtsprechung der deutschen Gerichte im Fluss befindet.
Das Gerichtssystem
Das Gerichtssystem besteht in erster Instanz aus mehreren Lokal- und Regionalkammern („local/regional divisons“) sowie aus der auf München und Paris (sowie zukünftig wahrscheinlich Mailand) aufgeteilten Zentralkammer („central division“) bestehen, deren Zuständigkeiten unterschiedlich bemessen sind. Ferner sind auch die Kammern unterschiedlich mit rechtskundigen („J“) und technischen („T“) Richtern besetzt.
Folgende Lokal- und Regionalkammern sind eingerichtet worden:
| Gericht | Zuständig für | Ort | Länder | Sprache2 | Richter (J/T) | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Stockholm | EE,LT,LV,SE | EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
2/14 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Wien | AT | DE, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Brüssel | BE | NL, EN, FR, DE | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Kopenhagen | DK | DK, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Paris | FR | FR, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
2/1 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Helsinki | FI | EN, FI, SE | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Düsseldorf, Hamburg, München, Mannheim | DE | DE, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
2/1 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Mailand | IT | IT, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
2/1 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Den Haag | NL | NL, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
2/1 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Lissabon | PT | PT, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Lokalkammern / Regionalkammern | Verletzungsklagen sowie Widerklagen auf Nichtigkeit1 | Ljubljana | SI | SI, EN | 3/03, bei Widerklage auf Nichtigkeit: 3/1 |
1/2 |
| Zentralkammer | Nichtigkeitsklagen sowie negative Feststellungsklagen5 | München:6 Pharma/Chemie (IPC Klassen C) Maschinenbau (IPC Klasse F) |
Alle Mitgliedsstaaten | Sprache des Klagepatents | 2/1 | Aus drei Ländern |
| Zentralkammer | Nichtigkeitsklagen sowie negative Feststellungsklagen5 | Paris: restliche Klassen | Alle Mitgliedsstaaten | Sprache des Klagepatents | 2/1 | Aus drei Ländern |
| Berufungsgericht | Alle Beschwerden und Berufungen | Luxemburg | Alle Mitgliedsstaaten | Sprache der 1. Instanz | 3/2 | Aus mindestens drei Ländern |
1 Die Kammer kann beschließen, bei Einreichung einer Widerklage auf Nichtigkeit diese oder mit Zustimmung der Parteien das ganze Verfahren an die Zentralkammer abzugeben, womit aber nur in seltenen Fällen gerechnet wird.
2 Wenn eine Sprache gewählt wird, die nicht die nationale Sprache ist (= Englisch), bestehen bei einigen Standorten Besonderheiten, so kann das Gericht entscheiden, die mündliche Verhandlung in einer nationalen Sprache zu führen und/oder das Urteil in dieser Sprache zu verfassen, wobei auf Kosten des Gerichts eine Übersetzung verfasst wird. S. Hierzu https://www.unified-patent-court.org/de/gericht/verfahrenssprache
3 Ein technischer Richter kann auf Antrag einer Partei oder Beschluss der Kammer hinzugezogen werden. Er muss bei Einreichung einer Widerklage hinzugezogen werden.
4 2/1 bedeutet: zwei Richter aus dem jeweiligen Land (bzw. bei einer Regionalkammer aus den jeweiligen Ländern), ein Richter aus einem anderen Land.
5 Wird bei Eingang einer negativen Feststellungsklage innerhalb drei Monaten vor einer Lokal- oder Regionalkammer Verletzungsklage eingereicht, so wird die negative Feststellungsklage ausgesetzt und nur die Verletzungsklage wird fortgeführt. In seltenen Fällen kann die Zentralkammer auch für Verletzungsklagen zuständig werden.
6 Dies ist eine vorläufige Verteilung (s. hier: https://www.unified-patent-court .org/en/news/decision-provisional-distribution-actions-related-patents-ipc-sections-and-c-pending-central), es ist geplant, dass Mailand als dritter Standort hinzukommt und die Hauptklasse A übernimmt, wobei ergänzende Schutzzertifikate (unabhängig von der Klasse) in Paris behandelt werden, s. hier: https://www.unified-patent-court.org/en/news/communication-administrative-committee-meeting-2-june -2023.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird in diesem System wohl keine primäre Rolle spielen. Lediglich in Bereichen, in denen es eine EU-weite Gesetzesregelung gibt, ist eine Rolle des EuGH für Vorlagefragen vorgesehen (Durchsetzungsrichtlinie, Biopatentrichtlinie, Verordnung zu Ergänzenden Schutzzertifikaten, Privilegierung klinischer Versuche unter der Arzneimittelrichtlinie, Wettbewerbsrichtlinie, Kartellrecht – „FRAND“). Ob sich eine generelle Zuständigkeit des EuGH aufgrund der Einheitspatentverordnung oder sogar des TRIPS-Abkommens ergibt, ist zwar von einigen Kommentatoren vorgebracht worden, scheint aber weniger wahrscheinlich.
Wichtig ist, das bei den Lokalkammern in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden sowie bei der Regionalkammer in Stockholm zwei der drei Richter aus dem jeweiligen Land bzw. den jeweiligen Ländern kommen.
Zuständigkeiten
Derzeit gehören dem Einheitspatentsystem folgende Staaten an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen. Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Slowenien. Für diese Länder wird das Einheitspatentgericht Zuständigkeit für Einheitspatente sowie die „klassischen“ Bündelpatente erhalten, nicht jedoch für rein nationale Patente. In Bezug auf Bündelpatente kann innerhalb einer Übergangsfrist per „opt out“ die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts blockiert werden (s. „opt-out“). Das Einheitspatentgericht wird ferner Zuständigkeit für ergänzende Schutzzertifikate haben, die auf Bündelpatenten oder später auch auf Einheitspatenten basieren. Ein „EU-SPC“, d.h. ein eigenes ergänzendes Schutzzertifikat auf Einheitspatente ist derzeit in der Planung und wird in den nächsten Jahren erwartet.
Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, die Zentralkammer primär für isolierte Nichtigkeitsklagen zuständig, während die Lokal- und Regionalkammern für Verletzungsklagen zuständig sind, bei denen auch Widerklage auf Nichtigkeit möglich ist, so dass damit gerechnet wird, dass die meisten Verfahren vor den Lokal- und Regionalkammern verhandelt werden.
Allerdings können letztere eine etwaige Widerklage auf Nichtigkeit dann entweder (a) mitverhandeln, (b) an die Zentralkammer verweisen und das Verletzungsverfahren aussetzen oder fortführen oder (c) den gesamten Fall mit Zustimmung der Parteien an die Zentralkammer verweisen. Fälle unter (b) oder (c) werden aber wohl die deutliche Ausnahme bleiben.
Ferner richtet sich die Zuständigkeit der lokalen und regionalen Gerichte nach (a) dem Ort der Verletzung oder (b) dem Sitz des Beklagten. In der Regel wird die Lokal- oder Regionalkammer, vor der geklagt wird, frei oder nahezu frei auswählbar sein.
Einstweiliger Rechtschutz
Das Einheitspatentgericht kann Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erlassen, einschließlich Beschlagnahme von Beweismitteln und Besichtigungen sowie einstweilige Verfügungen. Ferner gibt es die Möglichkeit, Schutzschriften zur Abwendung solcher einstweiligen Maßnahmen einzureichen.
Vor- und Nachteile des Einheitlichen Patentgerichts gegenüber den bisherigen nationalen Verfahren
Der Vorteil des Einheitlichen Patentgerichts ist die Möglichkeit, eine Patentverletzung für alle betreffenden Länder eines Europäischen Patents, die auch Mitgliedsstaaten des Übereinkommens sind, zentral führen zu können. Vor dem Einheitlichen Patentgericht besteht zudem der Anspruch auf Kostenerstattung. Bei Verletzung in mehreren Ländern bedeutet dies eine erhebliche Einsparung und auch die Vermeidung unterschiedlicher Gerichtsurteile. Allerdings werden gegenüber einem nur rein deutschen Verfahren die Kosten wohl höher liegen. Gegenüber einem deutschen Verfahren ist ein Vorteil, dass Verletzung und Nichtigkeit zeitgleich geprüft werden, so dass der zur Zeit eklatante Unterschied in der Verfahrensdauer zwischen Bundespatentgericht und den Verletzungsgerichten in Deutschland, der sog. „injunction gap“ nicht auftritt. Dies bedeutet eine erhöhte Rechtssicherheit für alle Beteiligten.
Vertretung
Neben Rechtsanwälten werden auch Europäische Patentanwälte, die über eine Zusatzqualifikation verfügen, vor dem Einheitspatentgericht in Alleinvertretung auftreten dürfen (s. „Vertretung“). Dies gilt für sämtliche lokalen und regionalen Gerichte sowie für die Zentralkammer. Unsere Kanzlei wird in der Lage sein, Sie vor dem Einheitlichen Patentgericht bei allen Verfahren zu vertreten.
-
+ Kann sich ein Unternehmen, ähnlich wie beim Europäischen Patentamt, von einem Angestellten, z.B. aus der Patentabteilung, vertreten lassen?
Nein, ein Angestelltenverhältnis bei der Partei alleine genügt nicht zur Vertretung. Ein Vertreter benötigt immer eine Vertretungsbefugnis als Rechtsanwalt oder als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt, der für das Einheitliche Patentgericht qualifiziert ist. Ob somit angestellte Syndikusrechts- oder Patentanwälte vor dem Einheitlichen Patentgericht auftreten dürfen, ist allerdings nicht vollständig geklärt, auch wenn dies weitgehend angenommen wird. Unsere Kanzlei wird in der Lage sein, Sie vor dem Einheitlichen Patentgericht in sämtlichen Verfahren zu vertreten.
-
+ Kann ich mich vor dem Einheitlichen Patentgericht durch meinen Patentanwalt vertreten lassen, oder muss ich zwingend einen Rechtsanwalt hinzuziehen?
Europäische Patentanwälte, die über eine Zusatzqualifikation verfügen, dürfen vor dem Einheitspatentgericht in Alleinvertretung auftreten. Sie müssen daher nicht zwingend einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Unsere Kanzlei ist in der Lage, Sie vor dem Einheitlichen Patentgericht bei allen Verfahren zu vertreten.
-
+ Müssen sich die Parteien einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nehmen?
Nein, ein einziger Vertreter genügt von Gesetzes wegen. Dieser kann ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt sein. Gleichwohl mag die Führung eines Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht mit Hilfe eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zusammen empfehlenswert sein, insbesondere bei komplexen und technisch anspruchsvollen Fällen. Unsere Kanzlei verfügt über ein lang eingeführtes Netzwerk mit ausgezeichneten, auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien.
-
+ Wie sieht das mit der Kostenerstattung aus?
Vor dem Einheitlichen Patentgericht existiert das Prinzip der Kostenerstattung, d.h. dass der Verlierer die Anwaltskosten des Gewinners zu tragen hat. Dabei können sowohl Rechtsanwalts- wie Patentanwaltskosten geltend gemacht werden. Allerdings existiert vor dem Einheitlichen Patentgericht neben der Möglichkeit, dass das Gericht die Kosten aufteilt – so wie dies ja auch aus den deutschen Verfahren bekannt ist – auch die Möglichkeit, dass das Gericht exzessive Kosten der Gewinnerpartei nur zum Teil als erstattungsfähig erachtet. Es existiert eine Art streitwertabhängiger „Kostendeckel“ dieser ist jedoch relativ hoch angesetzt und nur als absolute Obergrenze intendiert. Ob und wie das Einheitliche Patentgericht mit der Kostenerstattung umgeht, bleibt abzuwarten.
-
+ Ist ein Patentinhaber als Partei an den Vertreter gebunden, der das Prüfungserfahren vor dem Europäischen Patentamt geführt hat?
Nein, das Verfahren vor dem Einheitlichen Patengericht ist unabhängig von dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt. Insbesondere kann es auch sein, dass der Vertreter, der das Prüfungserfahren vor dem Europäischen Patentamt geführt hat, vor dem Einheitlichen Patentgericht gar nicht zugelassen ist.
-
+ Was sind die Vor- und Nachteile des Einheitlichen Patentgerichts gegenüber den bisherigen nationalen Verfahren?
Der Vorteil des Einheitlichen Patentgerichts ist die Möglichkeit, eine Patentverletzung für alle betreffenden Länder eines Europäischen Patents, die auch Mitgliedsstaaten des Übereinkommens sind, zentral führen zu können. Vor dem Einheitlichen Patentgericht besteht zudem der Anspruch auf Kostenerstattung. Bei Verletzung in mehreren Ländern bedeutet dies eine erhebliche Einsparung und auch die Vermeidung unterschiedlicher Gerichtsurteile. Allerdings werden gegenüber einem nur rein deutschen Verfahren die Kosten wohl höher liegen. Gegenüber einem deutschen Verfahren ist ein Vorteil, dass Verletzung und Nichtigkeit zeitgleich geprüft werden, so dass der zur Zeit eklatante Unterschied in der Verfahrensdauer zwischen Bundespatentgericht und den Verletzungsgerichten in Deutschland, der sog. „injunction gap“ nicht auftritt. Dies bedeutet eine erhöhte Rechtssicherheit für alle Beteiligten.
-
+ Ich möchte etwaige Patentkonflikte nicht auf europäischer Ebene führen, sondern lediglich auf nationale Ebene. Was muss ich tun?
Um ihre „klassischen“ Bündelpatente vor der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts zu blockieren, können Sie für eine Übergangszeit ein sogenanntes „opt out“ eintragen lassen. Ferner können Sie auch auf vermehrt auf rein nationale Patente setzen, die weiterhin der Zuständigkeit der nationalen Gerichte unterliegen. Eine weitere, allerdings auf Deutschland beschränkte Alternative ist eine Abzweigung eines Gebrauchsmusters.
-
+ Wir würden gerne das Einheitspatent und auch das Einheitliche Patentgericht nutzen, fürchten aber die zentrale Nichtigkeitsklage, die mit einem Schlag ein wertvolles Asset europaweit vernichten kann. Welche Strategien gibt es, um dieses Risiko zu minimier
Ein möglicher Weg ist, vermehrt auf Teilanmeldungen zu setzen, die im Vergleich zum Stammpatent einen leicht unterschiedlichen Schutzbereich haben und als Backup dienen können, ggf. als klassisches Bündelpatent und mit einem „opt out“ versehen. Ebenso können Sie ein Patent mit identischem Schutzbereich auch als deutsches nationales Patent parallel verfolgen, sofern für das europäische Patent dann kein „opt out“ beantragt wird, da hierfür das bislang geltende Doppelschutzverbot aufgehoben wurde.
Opt-out-Regelung
Für ein bisherigen EP-(Bündel-)Patent, d.h. ein nach dem EPÜ erteiltes Patent, das keine einheitliche Wirkung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 hat, also kein Einheitspatent ist, besteht während einer Übergangszeit eine parallele Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts und der nationalen Gerichte. Ferner ist dem Schutzrechtsinhaber eines solchen EP-(Bündel-)Patents während dieses Zeitraums die Möglichkeit eingeräumt worden, die ausschließliche Zuständigkeit des EPG (Einheitliches Patentgericht für die Regelung von Patentstreitigkeiten für die europäische Gemeinschaft mit einheitlicher Wirkung) für das EP-Patent auszuschließen (opt-out).
Für das Einheitspatent (europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung – ein nach dem EPÜ erteiltes Patent, das aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 einheitliche Wirkung) hat, gilt die opt-out Regelung nicht.
Die Erklärung (opt-out) ist gegenüber der Kanzlei des EPG (Einheitliches Patentgericht) über das CMS-System abzugeben und wird in das Register des Gerichts eingetragen. Die opt-out-Erklärung ist gebührenfrei.
Wichtig ist, dass ein opt-out dann nicht mehr möglich ist, wenn eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht betreffend dieses Patentes eingereicht wurde. Dies bedeutet, dass ein Dritter ein „opt-out dadurch aushebeln kann, dass er eine Nichtigkeitsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht einreicht. Auf der anderen Seite kann, wenn der Patentinhaber – oder ein dazu befugter Lizenznehmer – eine Verletzungsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht einreicht, nachher kein opt-out mehr erklärt werden.
Es ist derzeitig herrschende Meinung, dass die Opt-out Erklärung für die in Art. 83 (1) EPGÜ genannten Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen gilt, d.h. für alle Klagen innerhalb der Zuständigkeit des EPG nach Art. 32 EPGÜ. Ebenfalls soll ein opt-out die Zuständigkeit des EPG auch nach Ende der Übergangszeit für die Restlaufzeit des Patents ausschließen.
Die Übergangszeit (Artikel 83 EPGÜ), in der ein opt-out erklärt werden kann, beträgt sieben Jahre (genauer: sechs Jahre und elf Monate) nach Inkrafttreten, also zunächst bis zum 1. Mai 2030, kann aber bis auf 14 Jahre verlängert werden. Opt-out und opt-in sind an die Voraussetzung geknüpft, dass noch keine Klage bei dem bis zu der jeweiligen Erklärung zuständigen Gericht eingereicht wurde.
Das opt-out kann jederzeit, solange das Patent noch in Kraft ist, einmal rückgängig gemacht werden, man spricht vom „opt-in“. Dieser Antrag verläuft analog wie der opt-out-Antrag.
Für ein opt-in gibt es allerdings denselben Ausschluss wie bei einem opt-out, d.h. wenn ein Dritter vor einem nationalen Gericht Nichtigkeitsklage oder negative Feststellungsklage erhoben hat, ist ein opt-in nicht mehr möglich.